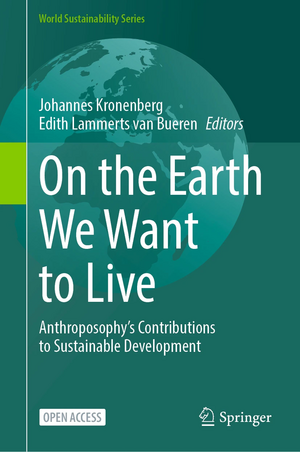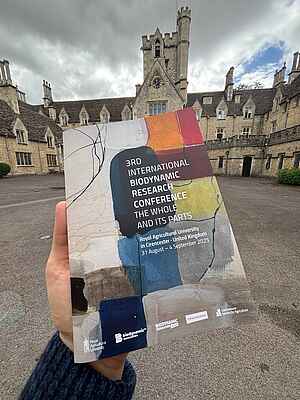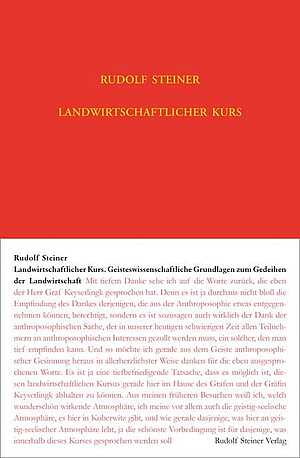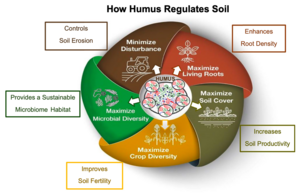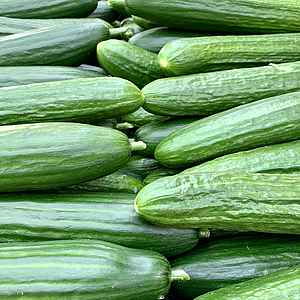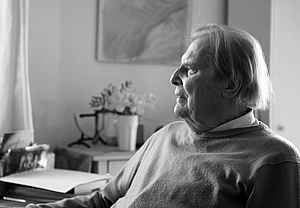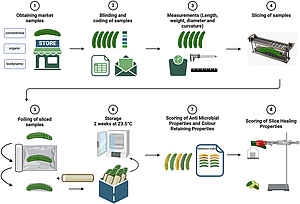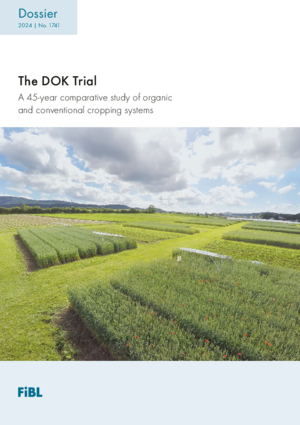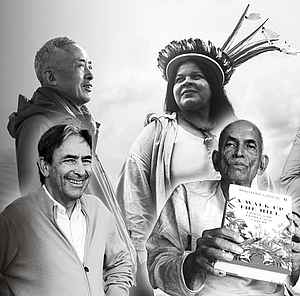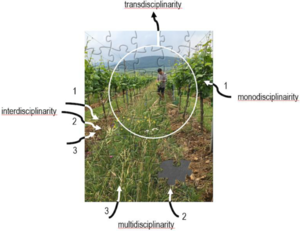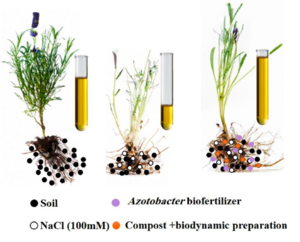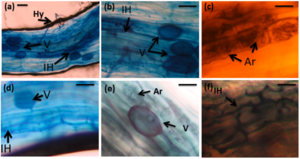News
Ein Fest der Gemeinschaft
You never farm alone – das Leitthema der Landwirtschaftlichen Tagung wurde vom 4. bis 7. Februar 2026 am Goetheanum lebendig erfahrbar. Rund 750…
Wissenschaftliche Fakten zur biodynamischen Lebensmittelqualität und zum Mikrobiom
Broschüren und Faktenblätter
Themenheft zur Landwirtschaftlichen Tagung 2026
Eduardo Rincón im Gespräch mit Wolfgang Held
You Never Farm Alone
Die Herausforderungen der biologisch-dynamischen Landwirtschaft sind soziopolitisch und ökonomisch hoch. Die Landwirtschaftliche Sektion antwortet…
Herzlich willkommen zur Landwirtschaftlichen Tagung 2026
You never farm alone. Lebendige Gemeinschaften für die Zukunft.
Stresstolerante Gurken, entspannte Kühe mit Hörnern
Forschung zeigt Beiträge der biodynamischen Landwirtschaft für Nahrungsmittelqualität, Tierwohl und Bodenfruchtbarkeit
Asiatische biodynamische Konferenz und Ausbildertreffen 2025
Mit Unterstützung der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum, der Biodynamic Demeter Federation und mehrerer regionaler biodynamischer und…
Wie die Umgebung heilt und unsere Sinne genährt werden
Beitrag zum Forschungsthema für die Podiumsdiskussion auf der Ruskin Mill-Konferenz «Food, Land and Nourishment» vom 4. bis 6. Juli 2025 in…
Das Potenzial von Mensch und Betrieb neu denken
Wie können Höfe uns helfen, Führung, Organisationskultur und die Zukunft unserer Gemeinschaften neu zu gestalten? In diesem Beitrag der…
Weihnachtsessen mit den Schwiegereltern
Das Weihnachtsessen mit den Schwiegereltern beeinflusst das Darmmikrobiom. Dies untersuchte eine Forschungsgruppe. Überraschenderweise stellte sie…
Neues Grundlagenwerk: On the Earth We Want to Live
Anthroposophy’s Contributions to Sustainable Development
Agri-Kultur als Grundlage der Gemeinschaft
Eröffnung der Landwirtschaftlichen Tagung 2026
Herausforderungen gemeinschaftlich lösen
Zur biodynamischen Landwirtschaft gehört die Pflege von Beziehungen
Video zum DOK-Versuch: Bodenstrategien gegen Klimastress
Eindrückliche Ergebnisse aus dem DOK-Langzeitversuch
Hans Martin Krause ist Mitarbeiter am FiBL und Versuchsleiter des DOK-Versuchs (Was ist der…
Lebensmittelqualität mit allen Sinnen erfahren
Am 9. November fand in Nürnberg die 56. Demeter Herbsttagung statt. Rund 40 Teilnehmende kamen zusammen, um sich unter dem Motto «Wirksensorik –…
World Goetheanum Forum 2025 in Sekem – Rückblick
Vom 24. bis 28. September 2025 trafen sich rund 150 Teilnehmende aus 20 Ländern in Sekem, Ägypten, um sich den sozio-ökologischen Herausforderungen…
Greening the Desert – Unmögliches wird möglich
Immer grössere Teile der Erde trocknen im Zuge des Klimawandels aus – und doch können mitten in der Wüste grüne Oasen, Lebensräume und damit auch…
Draußen zu spielen beugt Allergien bei Kindern vor
Allergien bei Kindern nehmen zu. Das mag am modernen Lebensstil und am mangelnden Kontakt mit der Natur liegen und geht mit einer abnehmenden…
Bodenaufbau braucht Zeit – Ergebnisse eines indischen Langzeitversuchs
Gesunde Böden sind von unschätzbarem Wert für die Landwirtschaft. Sie bauen sich nur langsam auf, degradieren aber bei unsachgemässer Bewirtschaftung…
Aus Wüsten werden lebendige Lebenswelten
Nachhaltige Landwirtschaftsprojekte aus Wüstenregionen präsentieren Best Practice am Goetheanum
Durch Mahlzeitenrhythmus entsteht Gesundheit
Unsere modernen Lebensbedingungen bringen den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Lot. Künstliches Licht – auch von Bildschirmen – oder…
Vielfalt stärkt Erde und Mensch
Anlässlich des Welternährungstags 2025 weist Ökotrophologin Jasmin Peschke auf die Bedeutung gesunder Ernährungssysteme hin
Dr. Jürgen Fritz erhält den Rudolf Steiner und Ita Wegman Preis
Für bahnbrechende biodynamische Forschung
ICONIC AWARD 2025 für Präparatepavillon am Goetheanum
Der neue Präparatepavillon nach einem Entwurf von Yaike Dunselman vom niederländisch-deutschen Architekturbüro 9grad architektur und Mitglied des…
Weltweite biodynamische Forschung im Dialog
Rückblick auf die dritte internationale biodynamische Forschungskonferenz
LOADS Collection: Erste Demeter-zertifizierte Textilkollektion weltweit
Ein Meilenstein für regenerative Mode
Biodynamische Getreidesorte Wiwa trotzt Nässe
Ein Beitrag in der Coop-Zeitung von Thomas Compagno
Dem Lebendigen auf der Spur
Ein ganzheitliche Annäherung von Mechtild Oltman-Wendenburg
Im Rhythmus der Erde
Biodynamik schlägt eine Brücke zu indigenen Weisheiten
Schulen, Universitäten, Heilorte
Was aus Bauernhöfen werden kann
Der Living Farms Podcast startet in die zweite Runde!
Neue Folge #23 mit Eduardo Rincón und Philipp Reubke
100% Bio-Einkauf ist möglich
Es ist bekannt, dass sich eine pflanzenbasierte Ernährung positiv auf Umwelt und Gesundheit auswirkt. Bio- und biodynamische Lebensmittel gelten dabei…
Nachhaltige Landwirtschaft funktioniert!
Vier praktische Visionärinnen gehen voraus.
Beeinflussen Pestizide das Körpergewicht?
Pestizide sind gesundheitsschädlich für Mensch und Natur. Dennoch wird heute die doppelte Menge wie im Jahr 1990 eingesetzt. Gleichzeitig steigt…
Demeter in der Zeitendämmerung
Wir stehen an einer Schwelle. Die vergangenen Jahrzehnte haben die Biobranche geprägt – durch Pioniergeist, Innovation und ein tiefes Verhältnis zur…
Neue Studie bestätigt menschlichen Einfluss auf die Biodiversität
Eine aktuelle Studie des renommierten «Nature»-Journals bestätigt, was Forschende und Laien gleichermassen schon lange vermuten: Der Mensch…
Biodynamische Präparate fördern Mikroorganismen im Boden
Modell von Jürgen Fritz erklärt statistisch signifikante Wirkung
Von hibernischen Mysterien und Zukunftskräften
Ein Irlandreisebericht von Co-Sektionsleiter Eduardo Rincón
Bildgebende Verfahren machen Weinqualität sichtbar
Wein ist Geschmackssache. Aber lassen sich Geschmack und Qualität messen? Und würden sie dabei einer chemischen Analyse eher trauen als einem…
Die Wasserqualität als Spiegel des Umgangs damit
Wasser ist eine lebenswichtige Ressource. Die weltweite Wassersituation zeigt, dass der aktuelle Umgang damit weder nachhaltig noch gesund ist. Die…
«Landwirtschaft gelingt nur gemeinsam»
Sektion für Landwirtschaft regt eine zukunftsfähige Landwirtschaft an
Biodynamische Pflanzenzüchtung in Sekem
Workshop-Bericht
Aufruf für Beitragsvorschläge zur Landwirtschaftlichen Tagung 2026
Jetzt Beitrag einreichen
Wie kann Forschung eine nachhaltige Landwirtschaft unterstützen?
Es braucht eine ganzheitliche Perspektive
Wie Humus unser Bodenklima beeinflusst
Humus ist gut für die Bodengesundheit. Doch wieso eigentlich? Was genau ist Humus, wie entsteht er, und welche Funktionen übernimmt Humus im Boden? In…
In welche Richtung geht die Ernährung?
Aktuelle Trends
Früh und stark
Die biodynamische Bewegung auf dem amerikanischen Kontinent
Wo die Biodynamik Wurzeln schlägt
Wie hat sich die Biodynamik in den letzten 100 Jahren weltweit entwickelt und ausgebreitet? John Paull und Benjamin Hennig liefern mit ihrer Studie…
Nahrung als Heilmittel für Boden und Mensch
Nur in lebendigen Böden können gesunde Nahrungsmittel erzeugt werden. Die biodynamische Landwirtschaft hat viele positive Effekte, einer davon ist der…
Stress-Lagerungstest – biodynamische Gurken sind am vitalsten
Die Vitalität von Gurken kann mittels eines Stress-Lagerungstests geprüft werden und ermöglicht damit eine Qualitätsbewertung, die über Inhaltsstoffe…
In Gedenken an Manfred Klett, 1933–2025
Manfred Klett ist am 2. April 2025 in den Stunden des anbrechenden Tages in Frieden über die Schwelle gegangen – auf «seinem» Dottenfelderhof,…
Die Wochenschriften zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025 sind da!
Tauchen Sie (nochmals) ein in die Inhalte der Landwirtschaftlichen Tagung 2025 und lesen Sie die Beiträge der Wochenschriften «Das Goetheanum» Nr. 8…
Von den Selbstheilungskräften gestresster Gurken
Wie wirkt sich das Anbausystem auf die Gesundheit und Lagerungsfähigkeit unserer Nahrungsmittel aus? Ein Team von Forschenden um Marjolein…
Transparente Preisgestaltung für mehr Bewusstsein und Fairness
Heute, am 6. März 2025, startet in Italien die Kampagne «Unterstützen wir die Landwirtschaft!» von NaturaSì. Deren Ziel ist es, durch eine…
Bakterien vom Acker bis zum Darm – ein Vergleich von biodynamischen und konventionellen Äpfeln
Der Zusammenhang zwischen Darmbakterien und menschlicher Gesundheit ist bekannt. Dahingegen ist weniger gut untersucht, wie sich…
Biodynamik in den Tropen
Ein Rückblick von Alex Edleson, biodynamischer Landwirt, Pflanzenzüchter und Berater, auf die Konferenz in Palawan, Philippinen, vom 28. November bis…
In Gedenken an Klaus Wais
* 20.02.1958 † 19.02.2025
Unser lieber Kollege Klaus Wais, engagierter Demeter-Pionier und langjähriges Vertreterkreismitglied, ist am 19. Februar…
«Indigene Kulturen helfen uns wiederzuentdecken, was Leben ist»
Interview mit Feya Marince, Mitbegründerin der Indigenous Biodynamic Association of Africa
Iranischer Safran und Appenzeller Jodel
Ein genussvoller Auftakt zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025
Jahresthema 2025/26
You never farm alone. Lebendige Gemeinschaften für die Zukunft
Leben gestalten – Zukunft säen
Ein Rückblick auf die Landwirtschaftliche Tagung 2025
Bald beginnt die Landwirtschaftliche Tagung
5.–8. Februar 2025 – jetzt Ticket kaufen
Demeter in der Flasche, aber nicht auf dem Etikett
Viele Schweizer Landwirt:innen verzichten freiwillig darauf, ihre Weine unter einem biodynamischen oder biologischen Label zu vermarkten, obwohl sie…
Herzliche Einladung zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025
Das Programm zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025 ist da!
«Wiederentdecken, was Leben ist»
Nachhaltige Anbaumethoden wie die Biodynamik sind weltweit erfolgreich
DOK-Versuch: Umfangreiche Publikation nach 45 Jahren Feldexperiment
Der DOK-Versuch wurde im Jahr 1978 gestartet. Koordiniert wird er vom FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) und Agroscope, und dient als…
SEKEM gewinnt Champions of the Earth Award 2024
Wir gratulieren ganz herzlich!
100 Jahre Biodynamik weltweit
Zweite Ausgabe des Magazins «Living Farms»
Unsere Erde, unsere Zukunft!
Eröffnung der Landwirtschaftlichen Tagung 2025
Vertiefung: Effekte des biodynamischen Präparats BD500 auf die Qualität von Trauben
Wie wirken sich das biodynamische Spritzpräparat BD500 und die Boden-Mikrovariabilität auf Weinreben und Trauben aus? Pierluigi Mazzei möchte diese…
Zucker – eine Frage der Balance
Wird dauerhaft zu viel Zucker gegessen, ist die Gesundheit einschließlich der Gehirnfunktion be-einträchtigt. Gleichzeitig sind die im Kindesalter…
Partizipative Aktionsforschung: Eine fruchtbare Partnerschaft zwischen Theorie und Praxis
Wie lassen sich Wissenschaft und Landwirtschaft besser verbinden? In einer Studie von 2024 geht Jean Masson dieser Frage gezielt nach. Er untersucht,…
Von der Autonomie des biodynamischen Hoforganismus
Kann ein moderner Bauernhof autonom sein? Für den vorliegenden Konferenzbeitrag beschäftigten sich Marion Lebrun, Martin Quantin und Cyrille Rigolot…
Wissenschaft spricht klar für biodynamische Landwirtschaft
Die Resultate des Langzeitversuchs DOK auf den Punkt gebracht
Obstplantagen: Nachhaltige Ansätze für gesündere Böden
Welchen Einfluss haben unterschiedliche landwirtschaftliche Praktiken langfristig auf das Bodenleben in Obstplantagen? Ein Team von Forschenden um…
Sind vegane Produkte Alternativen zu tierischen Produkten oder einfach anders?
Vegane Produkte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Manche sind überzeugt, eine gesunde und klimafreundliche Alternative zu bekommen und manche…
Vertiefung: Biodynamische Präparate können helfen, Salzstress in Lavendel zu reduzieren
Ein erhöhter Salzgehalt im Boden beeinträchtigt das Wachstum von Pflanzen. Doch können landwirtschaftliche Praktiken diesen Effekt mindern? Dieser…
Pilznetzwerke in Weinreben: Biodynamik steigert Bodenfruchtbarkeit
Wie beeinflussen verschiedene landwirtschaftliche Systeme Weinreben und Weinqualität? Ana Aguilar-Paredes et al. analysierte für diese Studie von 2024…
Selbstversorgung und Eigenständigkeit stärken
Biodynamische Landwirtschaft unterstützt das Anliegen des Welternährungstags 2024
Partnerschaftliches Arbeiten anstatt Gesetze und Vorschriften
Fruchtbare Böden, Biodiversität, gesunde Nahrungsmittel und partnerschaftliche Zusammenarbeit – diese und viele weitere Aspekte kennzeichnen die…
Biodynamische Landwirtschaft vollständig in die Heliopolis Universität integriert
Seit 2018 gibt es einen regen Austausch zwischen der Heliopolis Universität in Kairo und der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum in Dornach…
Essen neu erleben: Kunst trifft Kulinarik am Goetheanum
Zur Feier von 100 Jahren biodynamischer Qualität
Opportunismus – «zur Rettung des Bodens»
Die Studie ‹Die biodynamische Bewegung und Demeter in der NS-Zeit› stellt dar, wie eng die Verbindung zwischen biodynamischer Bewegung und…
Neue Forschung zu bakterieller Vielfalt in biodynamischen Präparaten
Vaish et al. untersuchen in der vorliegenden Studie die biodynamischen Präparate auf genetischer Ebene. Ziel ist ein besseres Verständnis ihrer…
Gesundheit für Mensch und Erde
Wie Transformation gelingen kann
One Health auf betrieblicher Ebene
Erfahrung aus 30 Jahren Betriebsführung in der Schweiz
Die Klimakrise aus der Perspektive des Landwirtschaftlichen Kurses
Verschriftlichter Impuls-Beitrag von Ueli Hurter zur Klima-Tagung „Menschlicher Wandel – Wie bilden wir eine Atmosphäre für die Erde?“, gehalten am…
Intensive Verarbeitung mindert die Qualität von Getreideprodukten
Frühstückscerealien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, sie gelten als gesund und auch Bio- und Demeter-Kund:innen greifen gerne darauf zurück.…
Menschenrecht gesunde Lebensmittel
Kurzfilm zu 100 Jahre biodynamische Landwirtschaft